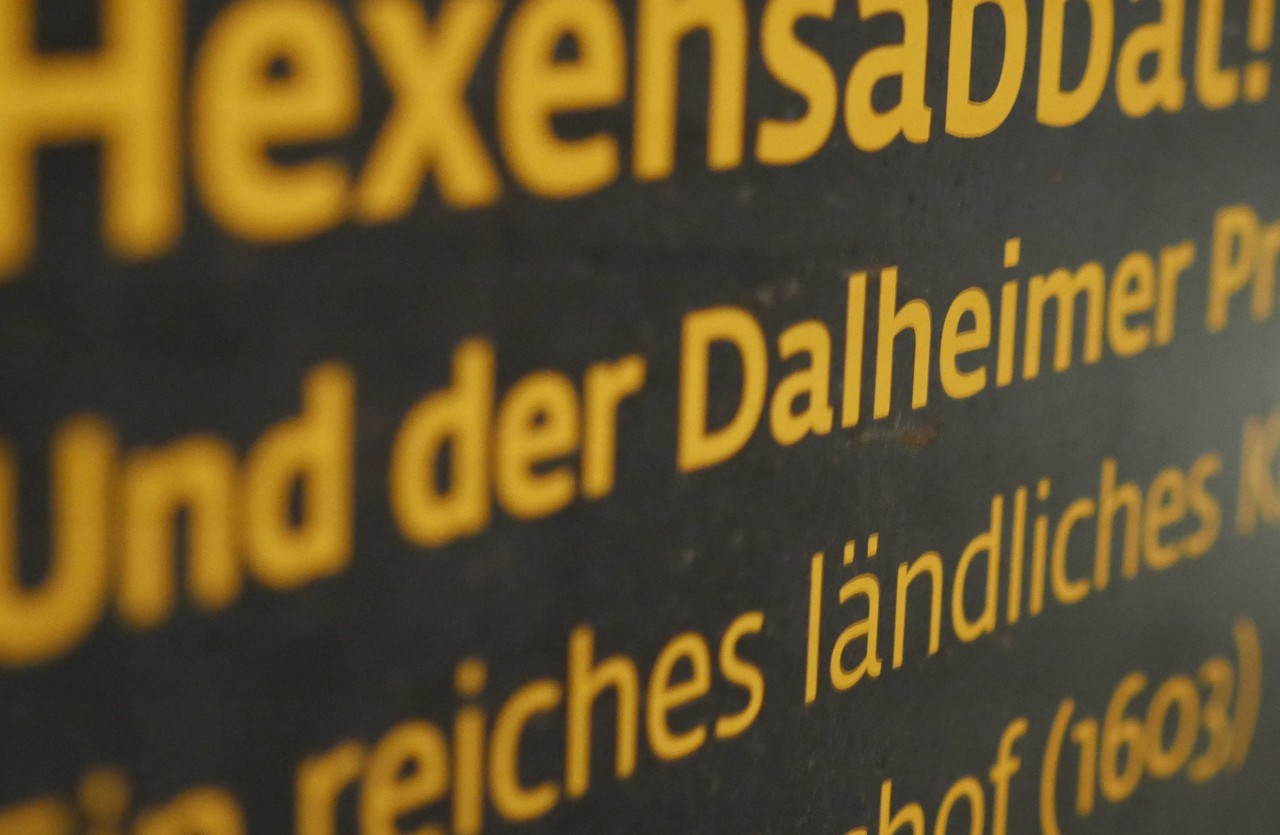Der Teufel im Kloster
Wörtlich heißt es in den Akten eines Höxteraner Hexenprozesses von 1631, der sich auf die Dalheimer Anklage bezieht: „Dass nemblich erwehnte Geistliche auf allen jeden zauberischen Beisambkunften und Buberei mitgepflogen“.
Bei vielen Leuten galt im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als unzweifelhafte Realität, dass der Teufel, Dämonen und ihre irdischen Vertreter, die Hexen und Hexer, existierten. Die Furcht vor Schadenszaubern war weit verbreitet, konnten sie doch angeblich Seuchen, Kindssterben oder Unwetterkatastrophen verursachen. Vermehrte Kriege, Pestepidemien und eine ausgeprägte Kälteperiode verschärften die Angst vor dunklen Mächten. Diese entlud sich in Hexenprozessen, die auch vor dem Paderborner Raum nicht Halt machten: Um 1600 wurden mehrere vermeintliche Hexen in Schloss Neuhaus hingerichtet. Hatten einige der Männer und Frauen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannten, die Dalheimer Ordensleute als Mittäter genannt?